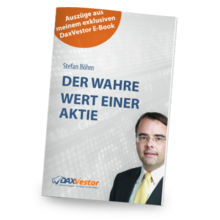Was steckt wirklich hinter „Quant-ETFs"?
Und gibt es sie überhaupt?

(Lars Erichsen) Der Begriff „Quant-ETF“ taucht immer häufiger auf; in Medien, Produktbeschreibungen und Diskussionen unter Anlegern. Viele stellen sich darunter ausgefeilte Algorithmen, KI-Modelle oder Hedgefonds-ähnliche Strategien vor, die in einem ETF verpackt sind.
Die Realität ist jedoch weit weniger spektakulär: Die meisten Produkte, die heute als „Quant-ETFs“ vermarktet werden, sind keine echten Quant-Strategien im institutionellen Sinne, sondern in der Regel einfache, regelbasierte Index-Konzepte. Es lohnt sich also genau hinzuschauen, was wirklich hinter ihnen steckt – und in welchen Bereichen Quant tatsächlich drinsteckt, wo Quant nur draufsteht und welche Produkte überhaupt infrage kommen.
Was bedeutet „quantitativ“?
Im professionellen Asset Management bezeichnet „quantitativ“ einen streng datengetriebenen Ansatz. Institutionelle Quant-Firmen arbeiten mit komplexen statistischen Verfahren, modellbasierten Prognosen, maschinellem Lernen, Risikoparitätsmodellen oder Intraday-Signalgeneratoren. Diese Strategien sind vollständig mathematisch gesteuert und bleiben bewusst geheim, da ihre Funktionsweise Geschäftsgeheimnisse sind.
Genau deshalb lassen sie sich nicht in transparente ETF-Strukturen übertragen, denn ETFs sind verpflichtet, ihre Portfoliostruktur offen zu legen – täglich und vollständig. Dadurch wäre jedes anspruchsvolle, proprietäre Quant-Modell sofort kopierbar. Die meisten komplexen Quant-Strategien bleiben daher in Hedgefonds oder spezialisierten, nicht-transparenten Fondsstrukturen und finden ihren Weg nicht in den ETF-Mantel.
1) SMART BETA
Was im ETF-Bereich am häufigsten, als „Quant“ vermarktet wird, sind Smart-Beta- oder Faktor-Strategien. Diese Produkte setzen unter anderem auf Faktoren wie Value, Momentum oder Marktkapitalisierung. Die Konstruktion ist regelbasiert, nachvollziehbar und methodisch sauber – dennoch bleiben diese Strategien einfach strukturiert, weil sie für die breite Öffentlichkeit funktionieren müssen. Sie gelten damit nur im erweiterten Sinne als quantitativ, sind jedoch weit davon entfernt, komplexe Hedgefonds-Algorithmen abzubilden.
» Vorteile:
• wissenschaftlich gut untersucht und empirisch belegt
• kostengünstig in der Umsetzung
• transparent, klar strukturiert und für Anleger leicht nachvollziehbar
» Nachteile:
• durchlaufen oft lange Zyklen der Underperformance – teils über mehrere Jahre
• starke Abhängigkeit vom jeweiligen Marktumfeld
• keine „smarten Algorithmen“ – die Logik basiert auf einfachen, festen Regeln
• Anleger neigen dazu, zu hohe Erwartungen an komplexe Modelle zu haben

2) MANAGED ETFs
Diese Produkte bilden keinen festen Index ab, sondern nutzen eigene quantitative Modelle zur Aktien-Auswahl. Hier kommen erstmals Ansätze zum Einsatz, die an institutionelle Quant-Methoden erinnern, etwa Scoring-Systeme, modellbasierte Faktorüberlagerung oder einfache maschinelle Lernverfahren.
Dennoch sind auch diese Strategien bewusst weniger komplex, um innerhalb der regulatorischen Transparenzvorgaben eines ETFs bestehen zu können. Viele dieser Produkte weichen nur moderat vom Referenzindex ab. Sie können theoretisch Alpha generieren, tragen aber immer das Risiko, dass ihr Modell in bestimmten Marktphasen einfach nicht funktioniert.
» Vorteile:
• Chance auf echtes Alpha, weil die Strategie flexibel reagieren kann
• breit einsetzbar, von Stock-Picking bis Risikomodellen
• kostengünstiger und transparenter als Hedgefonds
» Nachteile:
• Modellrisiko: Wenn das Modell nicht mehr funktioniert, bricht die Performance oft deutlich ein
• Over Fitting-Gefahr: Manche Strategien funktionieren nur in Rückrechnungen, nicht in der Realität

3) THEMEN ETFs
Themen-ETFs fokussieren sich auf klar abgegrenzte Zukunftsfelder wie künstliche Intelligenz, Robotik, Wasserstoff, Cyber-Security oder Weltraum-Technologie. Sie sind regelbasiert konstruiert und zählen damit formal zu den quantitativen Produkten, doch im Kern folgt ihre Konstruktion weniger einem wissenschaftlich definierten Faktor als vielmehr einer übergeordneten Erzählung oder einem langfristigen Trend.
Die Index-Anbieter wählen Unternehmen dabei anhand relativ einfacher Kriterien aus – etwa nach ihrem Umsatzanteil im jeweiligen Thema, ihrer technologischen Relevanz oder ihrer Branchenzugehörigkeit. Dadurch erhalten Anleger einen direkten, unkomplizierten Zugang zu Trendmärkten, müssen jedoch mit hoher Volatilität und deutlicher thematischer Konzentration leben.
» Vorteile:
• direkter Zugang zu klar definierten Zukunfts- und Wachstums-Themen
• überdurchschnittliches Potenzial in Hype-Phasen und starken Trendjahren
• thematische Fokussierung, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen
• für viele Anleger intuitiv verständlich und leicht greifbar
» Nachteile:
• häufig hohe Branchen- und Länder-Konzentration – erhöhtes Klumpenrisiko
• stark abhängig vom Stimmungsbild – lange Schwächephasen möglich
• oft mehr Marketing als wissenschaftlich fundierte Strategie
• hohe Volatilität und im Vergleich zu breiten Indizes höhere Risiken

4) RISIKOORIENTIERTE ETFs
Risikoorientierte ETFs verfolgen einen mathematisch optimierten Ansatz, der nicht primär auf Rendite-Maximierung abzielt, sondern auf die Reduzierung von Schwankungen und Verlusten. Zu diesen Strategien gehören unter anderem Minimum-Varianz-Portfolios, Low-Volatility-Indizes, risikoparitätische Modelle oder andere defensive Optimierungen.
Sie gelten als die wohl „quantitativsten“ aller regelbasierten ETF-Strategien, da ihre Konstruktion stark auf statistischen Risiko-Modellen beruht. Ihr Ziel ist es, das Portfolio möglichst stabil durch turbulente Marktphasen zu bringen, auch wenn dies bedeutet, dass sie in ausgeprägten Aufwärtsmärkten nicht vollständig mitziehen.
» Vorteile:
• deutlich geringere Schwankungen als der breite Markt
• bessere Stabilität in Krisen- und Korrekturphasen
• mathematisch fundierte Risikosteuerung
• besonders geeignet für risikoaverse oder langfristig defensive Anleger
» Nachteile:
• verpassen in starken Bullen-Märkten häufig einen Teil der Rendite
• können in Phasen steigender Zinsen oder starker Value-Rotationen hinterherhinken
• hohe Gewichtung defensiver Sektoren (z.B. Versorger, Basiskonsum) kann Klumpenrisiken erzeugen

Mein Fazit
Quantitative ETFs sind letztlich klassische ETFs, die mit einem regelbasierten, datengetriebenen Auswahlprozess arbeiten. Sie bringen Struktur ins Portfolio, reduzieren emotionale Entscheidungen und ermöglichen einen systematischen Zugang zu bekannten Faktoren wie Value, Momentum oder Quality.
Gleichzeitig sind sie kein Garant für Outperformance – auch quantitative Modelle unterliegen Marktzyklen und können über längere Zeiträume hinter traditionellen Indizes zurückbleiben. Quant-ETFs sind damit eher ein nützliches Werkzeug – nicht aber ein vollwertiges Ersatzprodukt für echte institutionelle Quant-Strategien.
Wichtig ist zudem: Reine, vollumfängliche Quant-Strategien – wie man sie aus dem professionellen Asset Management oder der Hedgefonds-Welt kennt – gibt es im ETF-Mantel nicht. ETFs können nur vereinfachte, stark standardisierte Varianten solcher Modelle abbilden.
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte:
Der Autor ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert: - - - Die Informationen in diesem Newsletter stellen keine Empfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar.
Bildquellen: © Adobe Stock - fraismedia